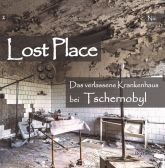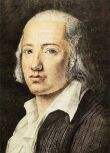Anekdote um Goethes Versepos „Hermann und Dorothea“
Gemeint mit dieser „neuen Kunst" ist jene Epoche, die erst im Laufe des 19. Jahrhunderts als „Weimarer Klassik" bezeichnet wurde. Diese zeichnet sich durch die Konzentration auf und Nachahmung der Werke der griechischen Antike aus. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Goethe jeden der neun Gesänge des Versepos mit den neun griechischen Musen betitelte, um ihn zu ordnen. Die Musen gelten als Symbole der Künste und der künstlerischen Inspiration. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf die ästhetischen Auseinandersetzungen, die die Weimarer Klassik bestimmten.
Auch das Verfassen von „Hermann und Dorothea" in epischen Hexametern liefert einen Anhaltspunkt auf den Rückgriff auf die Antike: Bekannte Werke wie die „Ilias" und die „Odyssee" des Homer wurden ebenfalls in diesem Versmaß verfasst.
Den „Gipfel" der Kunst bildet weiterhin, dass Goethe jene aktuellen Ereignisse um die Französische Revolution und die Flüchtlingstrecks der rheinischen Städte mit antiken Stilmitteln verband.
Durch die hohe Anzahl an Versen aber ist es verständlich, dass selbst ein großer Dichter nicht vor kleinen Fehlern gefeit ist. Und so kam es, dass sich eine „Bestie" in sein Epos einschlich.
„Herr Geheimrath," sagte einst ein junger Mann, den Goethe bei manchem was Metrik und Poesie überhaupt betraf, wohl mit unter zur Rede zu ziehen pflegte, „in Ihrem Gedicht Herrmann und Dorothea hab´ ich einen Hexameter gefunden, der einen Fuß zu viel hat." „Lassen Sie sehen, mein Lieber!" erwiderte Goethe. „Ja wahrlich!" fuhr er fort. „Indes, weil die Bestie einmal da ist, so mag sie ruhig dort bleiben."
Anekdote gefunden in: Das große deutsche Anekdoten-Lexikon, Verlag von Fr. Bartholomäus Erfurt 1843/44